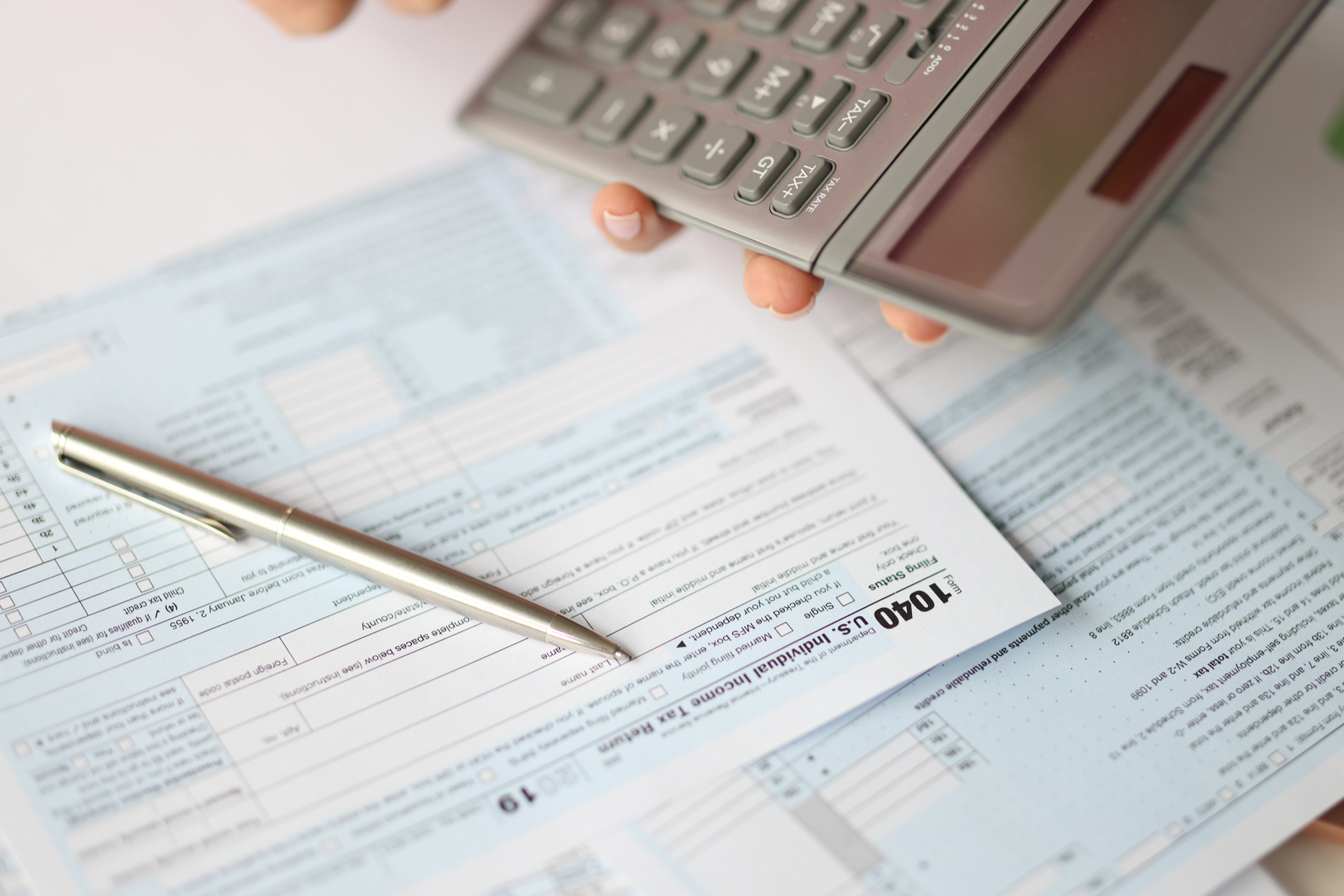Behandlungsfehler
Behandlungsfehler – damit Patienten nicht allein bleiben
Der Schock sitzt tief und die Enttäuschung ist den Patienten anzusehen – nach einem Behandlungsfehler hat sich die gesundheitliche Verfassung noch weiter verschlechtert. Die Betroffenen leiden extrem und sind oftmals im Alltag hilflos. Sie benötigen sogar Pflege, die von Profis oder den eigenen Angehörigen übernommen wird. Viele physische und psychische Einschränkungen belasten die Opfer von Behandlungsfehlern. Ausserdem müssen sie viel Kraft aufwenden, um ihre Rechte durchzusetzen.

Kunstfehler – wer informiert ist, hat es leichter
Mangelhafte Therapien sind keine Seltenheit. Die im umgangssprachlichen Gebrauch als Kunstfehler bezeichneten fachlichen Verfehlungen sind nach wie vor ein Thema für ehemalige Erkrankte, gesetzliche sowie private Krankenkassen, Versicherungen, Juristen, Ärztekammern und Gerichte. Kunstfehler oder Ärztepfusch sind, einfach ausgedrückt, ein nicht sachgemässes, den Patienten schädigendes Unterlassen oder Tun durch den Arzt. Ein Therapiefehler ist dann eingetreten, wenn eine medizinische Behandlung nicht dem allgemeingültigen standardisierten Vorgehen entspricht. Alle Therapien unterliegen einer Standardisierung beziehungsweise einer Vereinheitlichung sowie speziellen Massstäben, um deren Qualität und Erfolg zu sichern. Werden diese Massgaben verletzt, wird von Behandlungsfehlern gesprochen. Grundsätzlich kann es in den unterschiedlichsten Bereichen der medizinischen Versorgung zu einem Behandlungsfehler kommen:
- medizinisch nicht fundierte oder unzureichende Beratung innerhalb der Patientengespräche
- fehlerhafte oder ungenaue Erhebung eines Befundes
- Fehler bei operativen Eingriffen (Anästhesie, Wundverschluss)
- Abgabe oder Verabreichung falscher Arzneimittel
- fahrlässige Betreuung
- unsachgemässe oder lückenhafte Überwachung
- falsche Lagerung
- Behandlung passt nicht zur Diagnose
- individuelle Patientenrisiken nicht beachtet
- organisatorische Mängel
Das Auftreten von Behandlungsfehlern ist sowohl bei Ärzten als auch bei mittlerem medizinischem Personal wie Hebammen, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten und Kranken- sowie Altenpflegern nicht auszuschliessen.
Für die Bezeichnung Kunstfehler müssen mehrere Punkte nachweisbar sein:
- Eintritt des Schadens beim Erkrankten innerhalb der vergangenen drei Jahre
- Schädigung basiert auf Fehlverhalten des Behandlers
- Schädigung kann objektiv festgestellt werden
In der Praxis wird zwischen groben und einfachen Behandlungsfehlern unterschieden. Bei groben Behandlungsfehlern haben Ärzte eindeutig und massiv langjährig medizinisch gesicherte, geschulte Erkenntnisse oder sogenannte grundsätzliche ärztliche Therapieregeln vernachlässigt. Grobe Therapiefehler dürfen einem Mediziner eigentlich nicht passieren. Ergo hat der Arzt die Beweislast, dass es sich nicht um einen groben Verstoss handelt. Einfache Kunstfehler liegen vor, wenn Ärzte von den fachärztlichen Standards abgewichen sind. Ursachen sind in der Regel eine Verletzung der Sorgfaltspflicht oder organisatorische Fehler. Bei einfachen Behandlungsfehlern muss der Geschädigte den lückenlosen Beweis erbringen, dass ihm durch die Arbeit der Ärzte ein Schaden zugefügt wurde.
Handlungsanleitung bei Verdacht auf einen Behandlungsfehler
Rein zivilrechtlich betrachtet, werden Kunstfehler oder Ärztepfusch als Verletzung der im Behandlungsvertrag mit dem Patienten vereinbarten Pflichten angesehen. Dem Geschädigten steht unter gewissen Voraussetzungen ein Schadenersatz (materiell) und ein Schmerzensgeld zu. Urteile beinhalten ebenfalls strafrechtliche Massnahmen (Kunstfehler vorsätzlich als Körperverletzung) oder Freiheits- und Geldstrafen, Berufsverbot, Bewährung (beispielsweise bei Fahrlässigkeit). Besteht der Verdacht auf Ärztepfusch beim Umgang mit einem Erkrankten, sollte zunächst der Medizinische Dienst der Krankenkasse mit der Prüfung durch einen Gutachter beauftragt werden. Ein weiterer Schritt für Patienten ist das Hinzuziehen der Gutachterkommission der Landesärztekammer, die auf Therapiefehler spezialisiert ist. Ohne verlässliche und fundierte professionelle Hilfe und Begleitung ist ein solches Vorhaben für einen medizinisch unbedarften Laien nicht zu bewältigen. Die zuständige Krankenkasse berät und unterstützt betroffene Personen in einem solchen Fall.
Beweislage der Patienten
Die patientenbezogene Beweislast umfasst:- das Eintreten eines Kunstfehlers
- Ärztepfusch
- den Nachweis, dass die persönliche (psychische, physische) Schädigung die Folge des Kunstfehlers ist
- dass nur dieser spezifischen Behandlungsfehler den Folgeschaden ausgelöst hat
Beweise müssen sich nicht nur durch Gutachten ergeben. Sinnvoll ist es, sich Zeugenaussagen von medizinischen Mitarbeitern (Sprechstundenhilfe, Pfleger) und weiteren angestellten Ärzte zu besorgen. Des Weiteren sind Schilderungen und Aussagen von Bettnachbarn, Besuchern oder weiteren therapeutischem Personal hilfreich. Solche Darlegungen finden vor Gericht durchaus Berücksichtigung.
Haftungspflicht des Arztes bei einem Behandlungsfehler
Ärzte und medizinische Fachkräfte stehen in der Haftung, falls nachweisbar ist, dass die Sorgfaltspflicht vernachlässigt wurde. Bestehen während der Therapie normalerweise beherrschbare Risikozustände und versagt der Arzt in diesem Moment, ist ebenfalls ein Schadenersatz begründet. Eine Verpflichtung zum Schadenersatz durch den Arzt beruht einerseits auf der vertraglichen, andererseits auf der sogenannten deliktischen Haftung. Bei der zuletzt genannten Haftungsart wird der Mediziner persönlich und direkt für eigene Behandlungsfehler in Regress genommen beziehungsweise verurteilt. Er hat in diesem Zusammenhang die Patientensicherheit nicht gewahrt. Mediziner müssen zur Entlastung beweisen können, dass die Aufklärung des Patienten standardgemäss erfolgt ist (hinlängliche Beratung). Er muss zudem beweisen, dass der Patient in die Therapie eingewilligt hat. Dazu dienen zum Beispiel entsprechende Dokumente, die zuvor unterzeichnet wurden.
Beweislastumkehr: Hinter diesem Begriff verbirgt sich der Sachverhalt, dass ein Arzt in der Beweispflicht ist. Das heisst, er muss nachweisen, dass derselbe Kunstfehler hätte eintreten können, selbst dann, wenn der behandlungstechnische Umgang mit dem Erkrankten standardgerecht und ordnungsgemäss ausgeführt worden wäre.
Etwaige Forderungen auf Entschädigung lassen sich mit verschiedenen Mitteln durchsetzen, dazu zählen:
- Einigung der Parteien aussergerichtlich (Gutachten der Krankenkasse, ärztliche Haftpflichtversicherung)
- gerichtliche Klage (Amtsgericht oder Landgericht je nach Streitwerthöhe)
Die häufigsten Fragen zur Thematik Behandlungsfehler
Wer kann Schadensersatz fordern?
Einen Schadenersatzanspruch bei Behandlungsfehlern haben zunächst die Patienten. Versterben diese, können auch die Hinterbliebenen um die Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs kämpfen. Berechtigt sind Eltern minderjähriger Kinder und Jugendlicher. Die Geschädigten können neben Schmerzensgeld sowie materieller Wiedergutmachung eine zukünftige Ersatzpflicht erstreiten. Ein wichtiger Hinweis ist, dass die Verjährungsfrist ab dem Tag läuft, an dem der Patient Kenntnis von einem Kunstfehler hat.
Wer trägt die Kosten für ein ärztliches Gutachten bei einem möglichen Behandlungsfehler?
Werden medizinische Gutachten von einem Sachverständigen oder Experten für einen Rechtsstreit benötigt, ist die Kostenfrage unterschiedlich geregelt. Je nach Art des Gutachtens ergeben sich Ausgaben. Typisch sind diese für privat in Auftrag gegebene Begutachtungen. Wendet sich der Patient wegen eines Gutachtens an den Medizinischen Dienst der Krankenkasse, sind diese kostenfrei. Dasselbe gilt für Berichte, die von der Landesärztekammer angefertigt werden.
Welche Statistiken zu Behandlungsfehlern gibt es?
Die jüngst veröffentlichte Statistik über ärztliche Kunstfehler stammt von 2019. Erfasst wurden gesundheitliche Schädigungen, bei denen ein ursächlicher Zusammenhang zwischen unzureichender Aufklärung der Behandlungsrisiken sowie mangelhafter Aufklärung und Behandlungsfehler bestand. Auffällig ist, dass sogar Todesfälle und mit einer schweren, bleibenden Schadensfolge ausbehandelte Patientenzahlen zu finden sind. Insgesamt zeigt die Statistik mehr als 1.550 Kunstfehler innerhalb eines Jahres.
Wäre eine Strafanzeige gerechtfertigt, wenn man den Verdacht hat, dass dem Arzt ein Behandlungsfehler unterlaufen ist?
Innerhalb der geltenden Patientenrechte ist bei einem Fehlverhalten seitens des Arztes mit Folge Behandlungs- oder Befunderhebungsfehler und Körperschaden neben der zivilrechtlichen Verfolgung gleichermassen eine strafrechtliche Bewertung unerlässlich. Strafrechtlich dann, wenn durch die Staatsanwaltschaft ein Straftatbestand erwiesen wird. Klar ausgedrückt, ist jeder medizinische Eingriff eine Körperverletzung. Der Vorwurf der Körperverletzung wird durch die patientenseitige Einwilligung oder die mutmassliche Bejahung entkräftet.
Weitere Artikel zum Thema Versicherung & Rechtliches